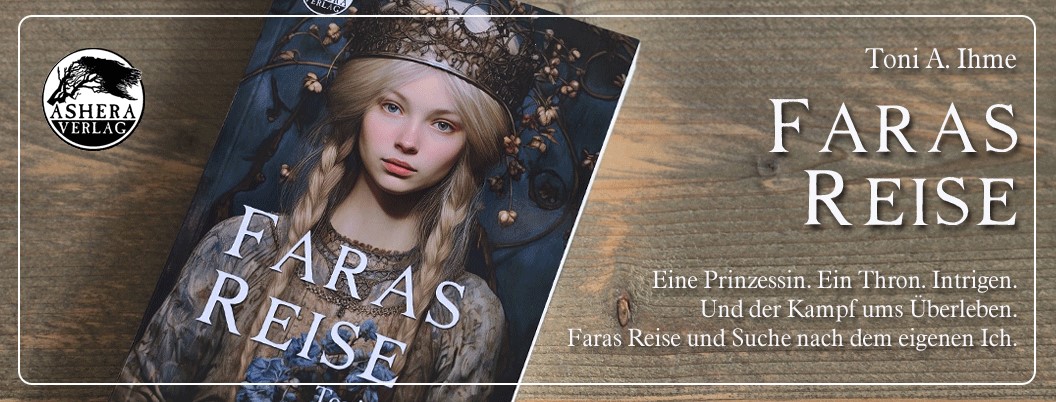Arkadi & Boris Strugazki: Gesammelte Werke 2 (Buch)
- Details
- Kategorie: Rezensionen
- Veröffentlicht: Mittwoch, 20. Oktober 2010 10:13
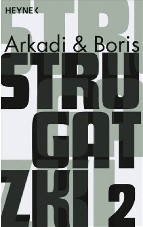
Arkadi & Boris Strugazki
Gesammelte Werke 2
Picknick am Wegesrand, Eine Milliarde Jahre vor dem Weltuntergang, Das Experiment
(?, (1972), Za milliard let do konca sveta (1976/77), Grad obretschenny (1988/1989))
Deutsche Übersetzung von Aljonna Möckel, Welta Ehlert und Reinhard Fischer, ergänzt von Erik Simon
Heyne, 2010, Taschenbuch, 912 Seiten, 12,99 EUR, ISBN 978-3-453-52631-0
Von Gunther Barnewald
Der zweite Band der Werksausgabe von Arkadi und Boris Strugatzki enthält den durch die kongenialen Verfilmung von Andrej Tarkowski bekanntesten Roman der russischen Brüder, nämlich „Picknick am Wegesrand“. Die Verfilmung aus dem Jahr 1979 unter dem Titel „Stalker“ ist zweifellos ein bemerkenswerter Film, aber auch der ursprüngliche Roman weiß den Leser zu fesseln und vor allem zu faszinieren.
Erzählt wird die Geschichte eines mysteriösen Besuchs von Außerirdischen, deren Anwesenheit auf der Erde seltsame Veränderungen hinterlassen hat. In den vom Besuch betroffenen fest umrissenen Zonen scheinen naturwissenschaftliche Gesetze außer Kraft zu sein, überall lauern Todesgefahren für die Menschen und von den ehemaligen Bewohnern der Zone sind viele gestorben. Wer die Zone verließ und sich irgendwo neu ansiedelte, brachte oft verhängnisvolle Effekte mit an den neuen Wohnort, so als klebe das Pech an den Emigranten. Aber in den Zonen warten auch wertvolle Artefakte, welche die menschliche Forschung weiterbringen könnten, weshalb eine Art Goldgräberstimmung auszubrechen droht, bis sich zeigt, dass die meisten der sogenannten Stalker, die sich auf die Suche begeben, in den Unwägbarkeiten der Zone ihr Leben lassen. Nur wenige überleben das Eindringen in die Zone. Ein besonders begnadeter Stalker ist Roderic Schuchart, der scheinbar intuitiv die Gefahren erkennt und nur deshalb noch am Leben ist. Als bei einer seiner Expeditionen jedoch ein guter Freund unter erschreckenden Umständen sein Leben verliert, obwohl dieser bereits in Sicherheit zu sein schien, beginnt Schuchart zu zweifeln an seinem Tun. Zudem gibt es eine staatliche Stelle, die zu verhindern versucht, dass die wertvollen Artefakte unter der Hand verscherbelt werden. Zu ihren Vertretern gehört Richard H. Nunnan, der versucht, Schuchart das Handwerk zu legen. Doch der junge Stalker zahlt für seinen Wagemut bald einen hohen Preis, denn seine erstgeborene Tochter ist eine Mutation und wird von den Erwachsenen ausgegrenzt und angefeindet. Schließlich wird auch Schuchart verhaftet und muss ins Gefängnis. Daraus entlassen entschließt er sich, noch einmal in die Zone zu gehen, um ein ganz bestimmtes Objekt auszuspüren, die sogenannte Wunschmaschine... Währenddessen entdeckt Nunnan, dass die Entwendung der Artefakte durch die Stalker weitergegangen ist, obwohl er glaubte, alle Schlupflöcher geschlossen zu haben...
Der Roman gewinnt vor allem durch die befremdliche Atmosphäre der Zone, die seltsamen Artefakte und Veränderungen in der Zone und zudem durch die innerlich zerrissenen Protagonisten, deren Verwirrung, Angst und Unsicherheit sich im manchmal beängstigenden Geschehen widerzuspiegeln scheinen. So ist „Picknick am Wegesrand“ vielleicht die atmosphärisch dichteste Geschichte der Strugatzkis, zudem ist er auch einer der lesbarsten Romane der beiden, sozusagen in Würde gealtert und auch heute noch genau so spannend und frappierend wie in den 70ern.
Die Idee des Besuchs der Außerirdischen, der dermaßen befremdlich verläuft, dass niemand weiß, ob die Aliens überhaupt noch da sind oder nicht, die ganze Fremdartigkeit des Geschehens und die menschliche Ohnmacht diesem gegenüber verbunden mit dem Gefühl, dass der Mensch klein und dumm allem gegenübersteht, verknüpfen die Autoren zu einem philosophischen Exkurs über die Unwichtigkeit der Menschheit. Starker Tobak für jeden Narzissten und eine Kränkung der menschlichen Selbstachtung, was sicherlich bei einigen Lesern zur totalen Ablehnung des Buchs führen dürfte, steht der ach so bedeutende homo sapiens hier doch wie ein primitives Tier vor einer Technik, die dermaßen fortschrittlich ist, dass er nicht einmal den Zweck vieler Artefakte verstehen kann, geschweige denn deren Auswirkungen auf die Natur.
Dass die Außerirdischen die Planetenbewohner zudem völlig ignoriert haben und entweder kein Kontaktversuch initiiert wurde oder dieser erst gar nicht als solcher erkannt wurde, war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von „Picknick am Wegesrand“ wohl ein völlig neuartige Idee (auch wenn Stanislaw Lem mit „Solaris“ das Thema Fremdartigkeit und Inkompatibilität von Lebensformen bei Kontaktversuchen bereits eindrücklich aufgeworfen hatte). Und genau diese Idee ist dermaßen faszinierend, dass sie die Handlung locker trägt.
Der zweite hier veröffentlichte Roman, „Milliarden Jahre vor dem Weltuntergang“ hat sich leider nicht ganz so gut gehalten, ist jedoch mit nur knapp 160 Seiten trotzdem lesbar geblieben.
Die Handlung spielt in einem Hochhaus in Leningrad, wo mehrere berühmte Wissenschaftler ihren Forschungen nachgehen. Durch seltsame Vorkommnisse werden diese jedoch an neuen Entdeckungen gehindert. Alle Seltsamkeiten für sich betrachtet scheinen fast erklärbar, jedoch die überzufällig Häufigkeit der Ablenkungen deutet darauf hin, dass irgendetwas oder irgendjemand nahezu allmächtiges versucht, die Wissenschaftler an ihren Entdeckungen zu hindern und dabei vor den skurrilsten Interventionen nicht zurückschreckt, so dass einer der Wissenschaftler sogar Selbstmord begeht.
Dabei hat der Roman die Form einer fragmentarischen Handschrift, die einzelnen Szenen beginnen und enden mitten im Satz und zwischen den Szenen gibt es Lücken, die der Leser durch Andeutungen der Autoren selbst füllen muss. Boris Strugatzki bezeichnet im Nachwort dieses Buch als sein persönliches Lieblingswerk, deuten die vielen Unwägbarkeiten und Eingriffe von „oben“ doch natürlich auf die allmächtige Zensur zur Sowjetzeit hin und sind Metapher für den Eingriff der Bürokratie und der Zensur auf das Leben aller kreativen Menschen. Etwas mangelhaft aus heutiger Sicht erscheint die der Form der persönlichen Aufzeichnung geschuldete stilistische Kargheit der Erzählung der Betroffenen, sind sie doch keine Schriftsteller, sondern Wissenschaftler, was zwar authentisch wirkt, jedoch den Lesegenuss erheblich schmälert.
Der dritte hier veröffentlichte Roman ist „Das Experiment“. Dieser erschien 1992 erstmals im Ullstein Verlag in deutscher Sprache unter dem Titel „Stadt der Verdammten“. Das Werk wurde von den Gebrüdern Strugatzki zwischen 1967 und 1972 geschrieben und verschwand gleich in deren Schublade, da sich beide darüber bewusst waren, dass es niemals würde veröffentlicht werden können in der damaligen Sowjetunion. Ganz im Gegenteil hätte das Werk zur Verhaftung der beiden führen können, wenn man es entdeckt hätte. Deshalb fertigte Boris zwei Abschriften an und man übergab das Buch an zwei entfernte aber vertrauenswürdige Freunde, die seine Existenz ebenso geheimhielten, wie die Autoren und einige eingeweihte Freunde. Erst im Zuge von Glasnost und Perestroika konnte diese Geschichte dann (in zwei Teilen 1988 und 1989) endlich veröffentlicht werden.
Geschildert wird die Geschichte des Russen Andrej Woronin, der im Jahr 1951 in eine merkwürdige Stadt kommt. Hier findet angeblich „Das Experiment“ statt. Viele Menschen weilen schon in der Stadt. Sie kommen aus aller Herren Länder, aber aus unterschiedlichen Zeiten, jedoch meistens aus der Zeit zwischen 1945 und 1967. Andrej beginnt seine Karriere als Müllfahrer, wo er die Invasion einer Pavianherde miterlebt, die den Bewohnern schwer zu schaffen macht. Mit vereinten Kräften wird man der aufsässigen Tiere jedoch Herr. Andrej freundet sich mit einem Juden namens Isja Katzmann an, aber auch mit einem SS-Offizier namens Fritz Geiger. Dies erweist sich bald als Glücksfall, denn Geiger gelingt es, sich ins Bürgermeisteramt zu putschen und die Macht zu übernehmen. Schließlich rüstet Geiger eine Expedition ins Unbekannte aus, um erforschen zu lassen, was jenseits der Stadt existiert. Woronin erhält das Kommando, ist er inzwischen doch Ratsmitglied der Stadt. Doch die Expedition droht zu einem furchtbaren Desaster zu werden. Durst, Durchfall und Krankheiten plagen die Männer, die Soldaten beginnen zu meutern. Und immer wieder trifft man auf alte Gebäude aus der Vergangenheit, deren Bewohner auf mysteriöse Weise verschwanden.....
„Das Experiment“ erweist sich bei näherer Betrachtung zwar als intellektuell ansprechendes aber nichts desto trotz phasenweise langweiliges Buch. So leidet „Das Experiment“ vor allem am mangelhaften Spannungsbogen, denn nach der Entdeckung des schauerlichen „Roten Gebäudes“ durch Woronin passiert erst einmal lange nichts. Obwohl der Roman ähnlich angelegt ist wie der Klassiker „Picknick am Wegesrand“ des Brüderpaares, so fehlen dem vorliegenden Buch doch die frappierenden und den Leser in Bann schlagenden Ideen, welche einen immer aufs Neue gefangennehmen. Weiteres Problem für den Leser sind diverse Anspielungen der Autoren, die ein nicht in der UdSSR aufgewachsener Rezipient nur schwer verstehen kann (zum Glück gibt es in der aktuellen Ausgabe hierfür mehrere kundige Nachbemerkungen von Boris Strugatzki, Karlheinz Steinmüller und Erik Simon). Generell krankt „Das Experiment“ wohl am Versuch der Autoren, zu viel Authentisches und Autobiographisches in der Geschichte unterzubringen. Darüber haben die beiden wohl etwas die Leser aus den Augen verloren, zeichneten sich die anderen Werke der Brüder doch meist dadurch aus, dass die beiden meisterhaft die Waage zwischen Unterhaltung und hohem Niveau halten konnten, ohne eine Seite zugunsten der anderen zu vernachlässigen. In der vorliegenden Geschichte ist dies leider missglückt, was dazu führt, dass der Lesegenus erheblich leidet, zwischenzeitlich das Gefühl der Langeweile aufkommt. Aus diesem Grund ist trotz des anspruchsvollen Inhalts „Das Experiment“ wahrlich nicht das beste Buch der Strugatzkis, auch wenn es summa summarum noch immer empfehlenswert ist.
In seinem Nachwort macht Boris Strugatzki nochmals klar, wie sehr man sich damals als Schriftsteller in der UdSSR in acht nehmen oder gegen Bürokratie, Zensur und menschliche Dünkelhaftigkeit und Beschränktheit kämpfen musste. Karlheinz Steinmüller ergänzt noch einiges hierzu und zum Werk in seinem anschließenden Essay, zudem helfen die erläuternden Bemerkungen Erik Simons dem Leser weiter.
So ist der zweite Band der Werksausgabe der Gebrüder Strugatzki ein Muss für alle SF-Fans, die sich ernsthaft mit dem Genre auseinander setzen wollen.