Jay Lake: Die Räder der Welt (Buch)
- Details
- Kategorie: Rezensionen
- Veröffentlicht: Sonntag, 25. März 2012 16:58
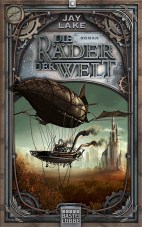
Jay Lake
Die Räder der Welt
Übersetzung: Marcel Bülles
Titelbild: Max Meinzold
Bastei Lübbe, 2012, Paperback, 364 Seiten, 12,99 EUR, ISBN 978-3-404-20656-8 (auch als eBook erhältlich)
Von Thomas Harbach
Mit „Die Räder der Welt” legt Bastei Lübbe unter dem nicht ganz korrekten Label Fantasy den ersten Band einer Steampunk-Trilogie des amerikanischen Science-Fiction-Autors Jay Lake auf deutsch vor. Im Gesamtwerk des für alle wichtigen Science-Fiction-Preise im Verlaufe seiner Karriere nominierten Lakes handelt es sich um die dritte Romanveröffentlichung.
Offensichtlich mit einem jugendlichen Helden auf ein eher heranwachsendes Lesepublikum zielend ist „Die Räder der Welt” eine ausgesprochen unterhaltsame und doch stellenweise extrem frustrierende Lektüre. Lake nutzt zwar das fast klassisch zu nennende Motiv der Queste inklusiv einer entsprechenden Entwurzelung des Protagonisten aus seiner keineswegs vertrauten Umgebung, um einen stringenten Plot zu etablieren, sucht aber mehrmals in schwierigen bis unmöglichen Situationen einen Ausweg, in dem er als allwissender Autor verschiedene Deus-Ex-Machina-Szenarien entwickelt, die weder überzeugend noch handlungstechnisch für den Leser nachvollziehbar sind. Im ersten Roman darf ein Autor derartige Aktionen versuchen, im dritten Roman sollte er routinierter und vor allem sorgfältiger planend vorgehen.
Lakes Handlung ist vor allem im Vergleich zur der dem Leser bekannten Historie schwer einzuordnen. Irgendwo zwischen der industriellen Revolution und einem in weiter Ferne heraufdämmernden 20. Jahrhundert hat der Autor seinen Plot in einem phantastischen Universum, allerdings voller religiöser Allegorien, angelegt. Die Fortbewegungsmittel sind nicht unbedingt in chronologischer Reihenfolge Pferdefuhrwerke, Schiffe und schließlich gigantische Luftschiffe. Lakes Erde ist am Äquator durch eine unüberwindliche – zumindest bis Lakes Protagonist kommt – Mauer geteilt.
Die Handlung beginnt auf der nördlichen Halbkugel, die von einem auf dem Höhepunkt seiner Macht stehenden britischen Königreich unter Königin Viktoria regiert wird. Lakes Erde ist wie das ganze Sonnensystem von Gott erschaffen worden, aber im Gegensatz zur Realität hat Lakes Gott ordentlich mit Schrauben, Federn und typischer Steampunk-Mechanik gearbeitet. So bewegt sich die Erde um eine gigantische Lampe, welche die Sonne darstellt. Die den Äquator umspannende Mauer ist in Wirklichkeit ein gigantischer Zahnkranz, auf dem sich die Erde auf einer Schiene um die Sonne bewegt. Pünktlich wie die Maurer. Doch diese Schöpfung ist im Gegensatz zum vor Jahrtausenden verschwundenen Gott fehlerhaft, wie eine Uhr nutzt sie sich ab. Die Feder muss wieder aufgezogen werden. Ob ein derartiger Vorgang – siehe auch Fernsehserien wie „Lost”, die auf einem kleinsten gemeinsamen Nenner mit dieser Idee innerhalb einer Staffel gespielt haben – schon einmal stattgefunden hat, ist unbekannt.
Eines Nachts erscheint der Erzengel Gabriel dem jugendlichen Protagonisten Hathor Jacques, der ihn auffordert, den sogenannten Hauptschlüssel zu suchen und die Feder der Erde wieder aufzuziehen. Anfänglich wirkt das christliche Bild des Erzengels Gabriel in einem ausschließlich vor einem phantastischen Hintergrund spielenden Roman wie ein Fremdkörper. Erst im Laufe seiner Suche beziehungsweise im wahrsten Sinne des Wortes seiner Mission erkennen Hathor Jacques und damit der Leser, wieviel die an den christlichen Glauben erinnernde Religion im Zuge der weltlichen Unwirtlichkeiten vergessen worden ist. So soll Jacques nicht nur die Erde vor dem Untergang, dem Stillstand auf ihrer Zahnradbahn retten, sondern indirekt auch den Glauben an den sich für die Menschheit auf den Statussymbolen der industriellen Revolution geopferten Jesus wieder herstellen.
Charles Dickens folgend entwurzelt Jay Lake seinen Protagonisten. Er wird von den neidischen Brüdern seines Lehrherrn, einer der letzten alten Uhrmachermeister, denunziert und schließlich ausgeraubt. Mittellos muss er sich auf die Suche machen, nachdem ihm – die erste Deus-Ex-Machina-Situation – eine Bibliothekarin hinsichtlich seines Traums geglaubt und ihn an die richtigen Stellen weitergeleitet hat. Immerhin hat Jacques bei seinem ersten Auftreten in der Bibliothek nicht nur gelogen, die Regeln der Kasten verletzt, sondern er kann keinen überzeugenden Beweis vorlegen, da ihm die vom Erzengel übergebene Feder gestohlen worden ist.
Am Königshof glaubt man ihm nicht. Er wird in einen Kerker geworfen, wo er schließlich von Seeleuten der königlichen Luftgarde im wahrsten Sinne des Wortes shanghaied wird. Innerhalb kurzer Zeit bringt Jay Lake seinen Protagonisten in eine aussichtslose Situation und befreit ihn wieder. Während er unter der Erde mit den eine Art archaische U-Bahn bauenden Gefangenen kaum warm wird, erscheint das harte Bordleben mit immerhin 24 Peitschenhieben für eine kleine Unachtsamkeit ein gutes Sprungbrett, um eine Art Hermann-Melville-Seeromantikgeschichte zu erzählen. Auch hier gelingt es Jacques durch eine Verkettung von eher konstruierten Situationen, vom Schiffsjungen zum Navigator aufzusteigen und vor allem die ganzen Fähigkeiten zu lernen, die er später während seiner Queste benötigt. Andere Begleiter auf seiner Reise wenden sich ihm ja nach Belieben zu oder verlassen ihn. Hier sei expliziert der egoistische Führer Malgus genannt, dessen Motive für beide angesprochenen Aktionen niemals vernünftig herausgearbeitet wird. Wenn Jacques aus tödlichen Situationen von nicht näher beschriebenen geflügelten Menschen gerettet oder verstoßen wird, ist die Konfusion perfekt. Obwohl Jacques ausgesprochen schnell lernt und sich immer wieder als talentiert und einzigartig erweist, traut Jay Lake in der viel zu langen und teilweise phlegmatisch geschriebenen Mittelphase seinen eigenen Fähigkeiten als Erzähler nicht. So führt der Autor in einer bislang viktorianisch technisch mechanisch gehaltenen Welt nicht nur Magie ein, sondern verleiht seinem jugendlichen Protagonisten überirdische, an eine Mischung aus Gandalf und Jesus erinnernde Fähigkeiten. Er rettet seine Reisegefährten und sich dank einer mit warmer Luft gefüllten Kugel aus der Antarktis. Wenige Szenen später erweckt er die Toten zum Leben. Erst wenn Jacques quasi in den gigantischen Mechanismus der „Weltuhr” dringt, fängt sich Jay Lake als Erzähler wieder und konzentriert sich auf seine Weltenschöpfung.
In dieser Hinsicht geht Jay Lake ausgesprochen geschickt vor. Zu Anfang werden Hather und der Leser durch die Vision mit dem Erzengel Gabriel über den katastrophalen Zustand der Welt informiert. Mit dem Aufbruch und gleichzeitigem Ausbruch aus seiner bisherigen Isolation lernen Protagonist und stiller Beobachter diese exotische und doch in vielerlei Hinsicht auch historisch-literarisch vertraute Welt kennen. Im Vergleich zu den später folgenden Elfenbeintürmen konzentriert sich der Autor auf ein viktorianisch vorindustrielles England, das der ganzen Welt den Union Jack aufgedrückt hat. Die erste richtig aufregende Passage ist die Reise an Bord des gigantischen Zeppelins durch einen die Existenz bedrohenden Sturm. Visueller Höhepunkt ist die Überwindung der die Welt in zwei Hälften teilenden Zahnradmauer mit die Senkrechten bewachsenden Bäumen und den in den Dschungeln verlorenen Städte inklusiv der entsprechenden Flora und Fauna. Wie Thomas Thiemeyer mit seiner Reihe um die versunkenen Welten gelingt es Jay Lake, eine abenteuerlich-phantastische Atmosphäre mit Pulp-Bezügen, aber ausgesprochen visuell beschrieben, zu erschaffen, in der sich der Leser verlieren kann.
Mit dem Überschreiten der Mauer fängt im Grunde ein neues Buch an. Auf der nördlichen Hemisphäre nutzte Hather ein gigantisches Zeppelin, im Süden erinnert manche Passage an Joseph Conrads Kurzroman „Heart of Darkness”. Nicht unbedingt als Ironie verstanden befindet sich Lakes Protagonist ja auch auf dem Weg zum Herzen Gottes und damit dem Zentrum der Welt.
Erstaunlicherweise trotz der frustrierenden Rückgriffe auf literarische Kniffe überzeugt Hather Jacques nicht nur als Charakter, sondern vor allem dank des erfolgenden Reifeprozesses auch als Mensch. Zu Beginn glaubt er als Einziger an seine Bestimmung, die er weniger in der Botschaft des Erzengels Gabriel erkennt, sondern vor allem in der Tatsache, das er als Uhrmacherlehrling mit einer abgebrochenen Ausbildung zumindest das theoretische Wissen sein Eigen nennen kann, um die Feder der Weltuhr wieder aufzuziehen. Dass die Bedrohung immer konkreter wird, unterstreicht der Autor sehr geschickt und impliziert, indem Jay Lakes natürliche „Weltuhr” durcheinander gerät und er nicht mehr genau auf die Sekunde weiß, wann Mitternacht ist. Am Ende des Buches überspannt der Autor allerdings den Bogen, indem er Hather Freude und Leid gleichermaßen erleben lässt. Er verliebt sich in ein Mitglied des ursprünglichen Volkes – elfengleiche Wesen – und muss sie mehrmals auf dem Weg ins Innere der Erde „opfern”, bevor er selbst mit der eigenen Sterblichkeit als Krüppel beziehungsweise Unsterblichkeit im Sinne der Religion konfrontiert wird. Zumindest macht der Autor nicht den Fehler, seine Figur diese Abenteuer unversehrt überstehen zu lassen, auch wenn der Versuch, das teilweise Happy End zu erzwingen, wieder nur dank literarischer Tricks und einer weiteren implizierten Annäherung Hathers an ein gottgleiches Wesen gelingt.
Es ist ein sehr schmaler Grat, auf dem sich der Autor bewegt, aber überwiegend gelingt es ihm, Hather auch auf dem Höhepunkt seiner Queste als bodenständigen, inzwischen gereiften jungen Mann darzustellen, der seine Mission über das eigene Schicksal stellt und dabei nicht wie ein klassischer Fantasyheld erscheint.
Dagegen wirken sehr viele der Nebenfiguren situationsbedingt und nicht dreidimensional charakterisiert. Sie erscheinen eher als notwendige Werkzeuge, denn abgerundete Figuren, die einen Kontrast zum entschlossenen Hather bilden sollten. Einen klassischen Antagonisten gibt es nicht, aber Jay Lake vermeidet auch, die ambivalent agierenden Figuren mit eigenen Überzeugungen auszustatten. So geht nicht nur die Individualität verloren, sondern viele spritzige Dialoge führen ins Nichts.
Zusammenfassend lebt „Die Räder der Welt” von der einzigartigen Weltschöpfung, die an Originalität Karl Schroeders Taschenuniversen in nichts nachsteht. Es ist schade, dass Lake im entscheidenden Augenblick zu wenig auf diese mechanische Welt eingeht und zu stark Gott als klassischen Schöpfer und nicht ersten Mechaniker sieht. Damit widerspricht er den Intentionen seiner grundlegenden Idee und verschließt sich einer Reihe von interessanten Implikationen. Aufgrund des hinsichtlich Hathers Zustand ambivalenten Endes darf der Leser gespannt sein, welche Herausforderungen den jungen Mann in den beiden Fortsetzungen erwarten und ob man mehr notwendige Informationen über die Mechanik der Welt und die sehr unterschiedlichen Kulturen auf dieser geteilten Erde erhält.
Handlungstechnisch über weite Strecken sehr solide geschrieben macht es sich Jay Lake fast naiv die Intelligenz seiner Leser ignorierend nicht selten zu einfach, um seine Figur aus den Schwierigkeiten wieder elegant herauszuholen, in die er sich ohne Rücksicht auf das Gesamtbild hinein geschrieben hat. Legt der Autor in den folgenden Romanen der Serie diese frustrierende Schwäche noch ab, gehört die Serie zu den empfehlenswertesten Steampunk-Titeln, die in letzter Zeit in Deutschland hier von Bastei Lübbe mit einem schönen Titelbild veröffentlicht worden sind.




