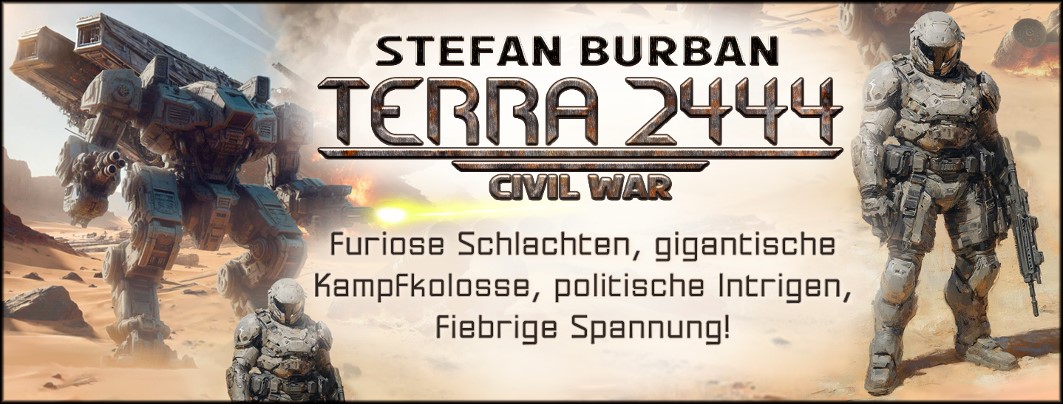Arkadi & Boris Strugatzki: Gesammelte Werke 4 (Buch)
- Details
- Kategorie: Rezensionen
- Veröffentlicht: Samstag, 24. März 2012 18:31

Arkadi & Boris Strugatzki
Gesammelte Werke 4
(Fluchtversuch, Es ist schwer, ein Gott zu sein, Unruhe, Die dritte Zivilisation, Der Junge aus der Hölle)
(Daleka ja Raduga (1962), Trudno byt’ bogom (1964), ? (1971), Malys (1974), Paren’ iz preispodnej (1990))
Deutsche Übersetzung von Dieter Pommerenke, Arno Specht, David Drevs, Aljonna Möckel und Erika Pietraß, ergänzt von Erik Simon
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design
Heyne, 2012, Taschenbuch, 880 Seiten, 12,99 EUR, 978-3-453-52686-0 (auch als eBook erhältlich)
Von Gunther Barnewald
Der vierte Band der Werksausgabe von Arkadi und Boris Strugatzki enthält den durch die Verfilmung bekannten Roman „Es ist schwer, ein Gott zu sein“.
Auch wenn die Verfilmung einige Wünsche übrigließ, so dürfte, nach „Picknick am Wegesrand“, dies noch immer das zweitbekannteste Buch der russischen Brüder sein. Neben dem bei Lesern extrem beliebten Roman „Die dritte Zivilisation“ liegen im vorliegenden vierten Band somit zwei der wohl besten Geschichten des Duos vor.
Nach dem ersten Band der Werksausgabe, welcher die drei Abenteuer des Maxim Kammerer („Die bewohnte Insel“, „Ein Käfer im Ameisenhaufen „und „Die Wellen ersticken den Wind“) enthielt, ist dies zudem der zweite Werksband, der Geschichten aus der Future History enthält, welche Arkadi und Boris im Laufe der Jahrzehnte erschaffen haben (nach dem Episodenroman „Mittag, 22. Jahrhundert“ wird sie auch oft „Welt des Mittags“ genannt).
Thema der vorliegenden fünf Geschichten ist eigentlich immer der Zusammenprall von Zivilisationen (oder von deren Repräsentanten), die auf stark unterschiedlichen technischen wie moralischen Entwicklungsstufen stehen.
In der ersten, nur knapp 140 Seiten dünnen Novelle „Fluchtversuch“, entdeckt ein irdisches Expeditionsteam aus dem 22. Jahrhundert auf einem fremden Planeten eine primitive, barbarisch agierende Zivilisation, deren Ansiedlung vom Eingriff einer hoch entwickelten Zivilisation, welche die Menschheit schon kennt und von ihnen als „Die Wanderer“ bezeichnet wird, tangiert wird. Die hochentwickelten Fremden sind dabei auch der menschlichen Technik so weit voraus, dass eine Verständigung mit ihnen bisher unmöglich war. Wo ihre Technik einwirkt, scheint keine Rücksichtnahme möglich. Sie bewegen sich auf der primitiven Welt riesige Maschinen eine geschaffene Straße entlang wie eine Ameisenkolonne, um an deren Ende per „Nulltransport“ wieder genauso mysteriös zu verschwinden, wie sie vorher an anderer Stelle aufgetaucht sind. Eine Ansiedlung der hiesigen Einwohner scheint von den Fremden zerstört worden zu sein. Doch der Verständigungsversuch der Erdenmenschen mit den einheimischen Barbaren schlägt ebenfalls fehl, denn diese sind zu sehr mit den Kämpfen untereinander beschäftigt beziehungsweise versuchen, indem sie verurteilte Verbrecher opfern, an die riesigen Maschinen heranzukommen. So erfahren die Protagonisten, unter denen sich ein mysteriöser angeblicher Historiker befindet, dass ein lokaler Diktator beschlossen hat, seine ehemalige reiche Oberschicht zu enteignen und diese der Zwangsarbeit zu unterwerfen, ebenso wie sämtliche Verbrecher, Revolutionäre oder sonstige ihm unangenehme Personen, die willkürlich verurteilt werden. Dabei geht man buchstäblich über Leichen. Entsetzt ziehen sich die irdischen Expeditionsteilnehmer wieder zurück, während sich der seltsame Historiker schlussendlich als Zeitreisender entpuppt, der wieder in seine Zeit zurückkehrt, nämlich in die besonders barbarische Zeit seiner Herkunft, also unsere Zeit (beziehungsweise in diesem Fall den 2. Weltkrieg, also Zeiten, welche die Autoren noch selbst miterlebt haben)...
In „Es ist schwer, ein Gott zu sein“ wird die Geschichte eines Beobachters von der Erde erzählt, der auf einem fremden Planeten als Adliger eine Tarnidentität angenommen hat. Hier herrscht finsterstes Mittelalter. Ein äußerst unfähiger Emporkömmling namens Don Reba versucht gerade, einen greisen und senilen Monarchen zu stürzen, während Don Rumata, so der hiesige Name des Erdenbürgers Anton aus dem 22. Jahrhundert, verzweifelt agiert, um einerseits nicht aufzufallen, andererseits aber einige einheimische Intellektuelle vor den antiakademischen Pogromen zu schützen. Denn sogar Einheimische, die des Lesens und Schreibens mächtig sind, werden in den Wirren vom „Volkszorn“ einfach abgeschlachtet. Bald muss auch der Mensch erkennen, wie grausam das hilflose Zusehen ist, denn die Direktive des Entwicklungsdienstes ist es, nicht in die inneren Belange einer Welt einzugreifen. Haben frühere Versuche doch gezeigt, dass man Zivilisationen nicht künstlich auf höhere Stufen heben kann, so lange ihre Bewohner nicht von selbst dazu bereit sind. Denn diese Versuche haben nur zu noch blutigeren Exzessen geführt (Fans der Serie „Star Trek“ werden sich nicht zufällig an die „Erste Direktive“ der Sternenflotte erinnert fühlen, jedoch stammt das Werk der Strugatzkis aus dem Jahre 1964, also aus einer Zeit, als „Star Trek“ noch nicht einmal konzipiert war). Doch gegen Ende schwindet auch Rumatas Widerstandskraft, vor allem, als die schlimmste aller Katastrophen für ihn eintritt...
Die nur knapp 130 Seiten starke Novelle „Unruhe“ ist sicherlich die schwächste Erzählung im vorliegenden Band. Die arg kryptische Geschichte ist die erste, stark abweichende Fassung eines der beiden Handlungsstränge des Romans „Die Schnecke am Hang“, welchen die beiden Autoren 1966/1968 veröffentlichten. Vorher schrieben sie 1965 ein Manuskript, welches sich nun hier findet. Wer den späteren Roman kennt, kann sich die Lektüre sicherlich ersparen, für alle Sammler ist die Novelle natürlich unentbehrlich, wirklich spannend oder hochklassig wird sie dadurch aber leider nicht.
Anders wieder „Die dritte Zivilisation“, zu dem Boris Strugatzki in seinen Anmerkungen wohl zu recht notiert, dass es das apolitischste Werk der Brüder ist, was wohl dazu geführt hat, dass die Geschichte ein zeitloser Klassiker geworden ist, fernab aller hemmenden Zeitbezüge. Bei den Lesern erfreut sich dieses Buch nach wie vor großer Beliebtheit (meines Erachtens völlig zu recht), obwohl die beiden Autoren mit dem Werk irgendwie unzufrieden waren, nachdem sie es beendet hatten, auch Kritiker an dem Buch herumnörgelten, so Boris Strugatzki.
Erzählt wird die Geschichte einer Weltraumexpedition, die einen scheinbar leeren, jedoch lebensfreundlichen Planeten entdeckt. Der Ich-Erzähler Stas Popov berichtet, dass die scheinbar leere Welt einerseits idyllisch wirkt, andererseits Befremden ob ihrer geisterhafte Leere auslöst. Dann findet man aber ein altes, abgestürztes Raumschiff von der Erde. In ihm starb offensichtlich ein Ehepaar. Doch wo ist das einjährige Baby der beiden geblieben, dessen Leiche sich nicht finden lässt? Schon vorher hatten alle Expeditionsteilnehmer verschiedenartige, meist (aber nicht nur) akustische Halluzinationen, die sich jedoch keiner eingestehen will (wer hält sich schon selbst gern für erkrankt an einer Schizophrenie!). Vor allem Popov, aus dessen Sicht erzählt wird, zweifelt an seinem Verstand, traut sich aber nicht, mit den anderen über die merkwürdigen Wahrnehmungen zu reden. Dann stellt sich heraus, dass sie von dem noch immer lebenden Kind stammen. Der Junge wurde von fremdartigen Wesen, die nur als eine Art Energie auf dem Planeten zu Hause zu sein scheinen, verändert und aufgezogen, ohne selbst deren Einfluss wahrzunehmen. Nachdem man die Fremden entdeckt hat, beschließt man den Planeten nicht zu besiedeln, versucht aber zu dem Jungen Kontakt aufzunehmen, da dies zu den Fremden unmöglich scheint. Der Junge ist jedoch recht fremdartig geraten, stellt mittlerweile eine Art dritte Zivilisation dar und man kann ihn und seine Weltsicht nur bedingt verstehen...
Die ebenfalls nur knapp 130 Seiten lange Novelle „Der Junge aus der Hölle“ variiert das sattsam bekannte Thema der Strugatzkis nochmals. Ein junger, zur Tötungsmaschine erzogener, indoktrinierter und Gehorsam gewohnter Soldat eines fremden Planeten wird von einem irdischen Beobachter des 22. Jahrhunderts vor dem sicheren Tod bewahrt und zur Erde gebracht, wo er die Segnungen der modernen Technik, Kultur und Ethik kennenlernt. Doch eigentlich möchte der „Sturmkater“ genannte Krieger nur zurück auf seine Welt, seinem Herren loyal dienen und weiter Blut vergießen, denn etwas anderes hat er nie gelernt in seinem jungen Leben (man denke hier an Andrej Tarkowskis Meisterwerk „Iwans Kindheit“). Schließlich darf der „Sturmkater“ zurückkehren auf seine Welt, doch ob er etwas von der menschlichen Zivilisation gelernt hat oder sich weiter als Tötungsmaschine verdingen wird, bleibt offen...
Gerade anhand der letzten Novelle wird nochmals deutlich, wie sehr die Strugatzkis Kinder ihrer Zeit waren. Denn Arkadi, Jahrgang 1925, nahm noch am „großen vaterländischen Krieg“ gegen die deutsche Armee teil, während sein Bruder, Jahrgang 1933, in der Heimat, eingeschlossen von den deutschen Feinden, fast verhungert wäre. Beide hat diese Zeit, dieser Krieg, das Blutvergießen und das Elend geprägt. Entsprechend lebendig sind ihre Beschreibungen der Gräueltaten und der Verrohung in barbarischen Zeiten.
Dass die beiden diese Erlebnisse kongenial in fesselnde und überaus intelligente Zukunftsvisionen übertrugen, dass ist alleine das Verdienst der Brüder.
Wie immer in den Werksausgabe-Bänden gibt es auch hier editorische Anmerkungen von Boris Strugatzki, der vor allem in den 60er Jahren ein zunehmendes Klima des Misstrauens, der Bespitzelung und gegenseitiger Denunziation beschreibt. Für die russischen Brüder wurde es immer schwerer, einen Absatzmarkt für ihre Werke zu finden. Nach einer Tauwetterzeit nach Stalins Tod begann in den 60er Jahren eine erneute Erstarrung in der Sowjetunion, welche Anfang der 70er noch schlimmer wurde. Die Strugatzkis erschienen zu kritisch, zu „judenfreundlich“ (hier ein schönes Zitat von Seite 870 der vorliegenden Ausgabe vom Chef der staatlichen Filmkommission, geäußert gegenüber Andrej Tarkowski, dem berühmten Filmregisseur: „Denken Aie daran, dass die Strugatzkis schwierige Leute sind... Ins Szenarium für den Kinderfilm „Der Kampfkater“ haben sie die zionistische Idee eingeschmuggelt, dass alle Juden in ihre Heimat zurückkehren und für ihre Interessen kämpfen solle“; der Film, der genau auf der hier vorliegenden Novelle basieren sollte, wurde deshalb erst gar nicht realisiert), zu pessimistisch, zu unwissenschaftlich, fanden ihrerseits immer weniger Publikationsmöglichkeiten.
Besonders interessant ist einer der Abschnitte, in dem aus einem Bericht Arkadis zitiert wird über eine Schriftstellerkonferenz russische SF-Autoren in den 60er Jahren, in denen die üblichen Verdächtigen ihrer Kleingeistigkeit freien Lauf lassen nach dem Motto: „Was über meinen flachen Tellerrand von Horizont hinausgeht, kann nur bedrohlicher Schmutz sein!“. Zwar kam es dann doch zu keinen Verhaftungen und Denunziationen, aber interessant sind diese Interna schon und sehr eindrücklich, was das damalige Klima anbetrifft.
Gleiches gilt für die Anmerkung von Boris Strugatzki, dass der böse Don Reba aus „Es ist schwer, ein Gott zu sein“ eigentlich Don Rebija hätte heißen sollen, dass dieses durchsichtige Anagramm für Stalins Geheimdienstchef Berija jedoch zu offensichtlich schien, weshalb der befreundete Schriftsteller Iwan A. Jefremov den beiden vorschlug, den Namen zu ändern. So entstand Don Reba, sozusagen als Abkürzung.
Wer sich nochmals ungekürzt und ausführlich erklärt mit dem wunderbaren Werk der Strugatzkis auseinandersetzen will (oder diese phantastische Welt gar erstmals entdecken darf), der kommt gerade am vierten Band der Werksausgabe voll auf seine Kosten. Auch wenn „Unruhe“ wahrlich kein Highlight ist, so stehen die anderen vier hier veröffentlichten Texte doch mit für das Beste, was die beiden Russen jemals erschaffen haben; und damit für das Beste, was die SF-Literatur jemals hervorgebracht hat.