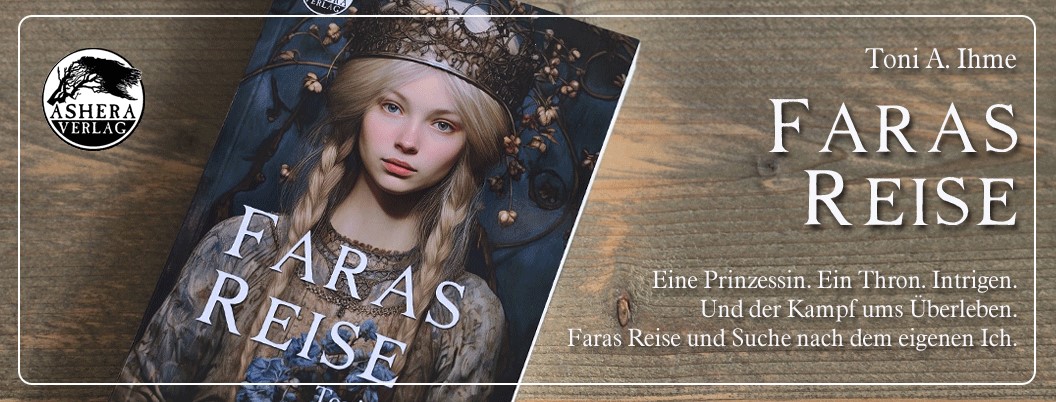Alexander Bach: Das Haus in der Rotscherzgasse und andere unwirkliche Geschichten (Buch)
- Details
- Kategorie: Rezensionen
- Veröffentlicht: Montag, 01. Juli 2019 21:53
Alexander Bach
Das Haus in der Rotscherzgasse und andere unwirkliche Geschichten
Goblin Press, Paperback, 12,00 EUR
Rezension von Uwe Voehl
Eine der interessantesten Veröffentlichungen in der Goblin Press ist dieses Buch, das neben der Titelgeschichte weitere Storys des Autors aus den Jahren 1992 bis 1996 versammelt. Es handelt sich ausdrücklich um keine Horrorgeschichten, und auch passt der Begriff Phantastik nicht unbedingt. Einige könnte man der Richtung Phantastischer Realismus zuordnen, aber dafür sind sie zumeist zu handlungsarm. Im Grunde handelt es sich um verzauberte Vignetten, in denen ein Ich-Erzähler (man könnte meinen, es ist immer derselbe) in eine Situation gerät, die ihn aus dem Alltäglichen herausdriftet. Der Autor selbst spricht von „Grauer Literatur“.
In „Des jungen Künstlers Selbstporträt nach der Lektüre Gustav Meyrinks“ begegnet ein Schriftsteller auf der Parkbank einem alten Mann, der im Schein einer Gaslaterne ein Buch liest und dem Schriftsteller einen vorwurfsvollen Vortrag über dessen Unfähigkeit hält. Selbstredend hat diese Geschichte auch eine Pointe, ist aber nach bereits 4 Seiten so schnell wieder vorbei, dass wir bereits in der nächsten versinken: In „Entlarvt“ verpasst ein junger Mann eine Frau, die mit dem Zug dort ankommen wollte. In seine Einsamkeit versunken und über die verpasste Chance dieser Begegnung nachgrübelnd, gerät er in einen Laden voller Masken. Sind es die Masken, die ihn mit seinen Selbstvorwürfen konfrontieren oder reflektiert der Mann selbst darüber? Wir wissen es nicht…
Diese wie auch viele anderer der Miniaturen sind eher Grotesken und erinnern mich an manche Schriftsteller der Décadence, wie sie zum Beispiel in der Zeitschrift „Der Orchideengarten“ gehäuft veröffentlicht wurden. Auch Bachs Sprache ist zumeist dieser Periode verhaftet und wirkte bereits zum Zeitpunkt der Entstehung der Geschichten altertümelnd.
„Rund-, Rück- und Umwegfahrten“ könnten einem Gedanken Kafkas entsprungen sein: Ein (wiederum!) junger Mann erblickt in der davonfahrenden Bahn eine Frau, die ihn derart fasziniert, dass er sie verfolgt. Doch das Bahnnetz erweist sich als Labyrinth. Mehrmals glaubt er die Frau wiederzusehen, doch es ist immer eine andere… In diesem Falle erwartet uns ein metaphysischer Schluss.
„Der Kunsthandwerker“ ist eine feine kleine Miniatur über einen Jungen, der in einen seltsamen Laden gerät, in der die Dinge alle scheinbar zu nichts nutze sind: Eine Flöte ohne Löcher, eine Kanne ohne Henkel… Doch der alte Mann, der den Plunder feilbietet, hat damit ganz Besonderes im Sinn… Diese Geschichte ist eine gelungene Allegorie, den wahren Wert der Dinge zu erschauen.
Die beiden folgenden jeweils nur auf 2 beziehungsweise knapp 3 Seiten platzierten Geschichten „Phobie“ und „Die Schmuckdose“ sind eng verwandt: In beiden verabschiedet sich der Erzähler in beinahe euphorischer Stimmung einmal von einem befreundeten gastgebenden Pärchen, das andere Mal von einer Jugendfreundin, um danach in eine abgrundtiefe Angststörung zu fallen. Laut Definition ist Phobie ein Angstgefühl, das in bestimmten Situationen auftritt oder beim Anblick bestimmter Dinge ausgelöst wird und den davon betroffenen Menschen immer mehr einschränkt. Dieses Gefühl in Literatur zu gießen, ist dem Autor eindrucksvoll und auf beklemmende Weise schon in sehr jungen Jahren gelungen.
In der nur zweieinhalbseitigen Kurzprosa „Wasted and Wounded“ verdichtetet sich die Lebensverdrossenheit zur Todessehnsucht. Die „Welt da draußen“ wird nur noch als Kälte empfunden, und dennoch zieht es den Erzähler immer wieder hinaus, um der Einsamkeit zu entrinnen. Es gipfelt in dem verstörenden Satz: „Warum nur war es mir so schwer… zum Beispiel jetzt das Fenster zu öffnen und mich hinunterzustürzen, zu dem Altpapier, wo ich hingehörte?“ Niemandem wünscht man eine derartige Stimmungslage, und ich kann nur hoffen, dass der Autor sie bestenfalls gestreift hat. Die Geschichte ist Teil eines Leseprogramms, mit der sich der Autor laut eigener Aussage seinerzeit erstmals an die Öffentlichkeit gewagt hat. Man kann nur vermuten, wie verstörend sein Vortrag auf das anwesende Publikum, das sich vielleicht einen unterhaltsamen Abend versprochen hatte, gewirkt haben mag.
Die nächsten beiden Geschichten, „Aus der Ferne betrachtet“ und „Herbstgang“, sind persönliche Reflexionen, wobei die erste so etwas wie eine Schlüsselgeschichte für diesen Band ist (sieht der Erzähler im Fernrohr doch einen Mann, der sich letztlich - und hier verrate ich die Pointe ausnahmsweise - als er selbst herausstellt) wie man den Eindruck hat, dass die meisten der hier versammelten Storys sehr mit dem Autor und dessen Stimmungen und Beobachtungen verflochten sind. So auch „Herbstgang“, wo eigentlich nichts passiert. Es handelt sich um eine Naturbeobachtung, mit ausdrücklichen Verweisen auf Caspar David Friedrich und Hermann Hesse.
Es schließt sich an „Das Haus in der Rotscherzgasse“, das vielleicht einzige wirkliche übernatürliche Horror-Stück in dieser Sammlung. Auf nur knapp 3 Seiten verdichtet der Autor gleich ein ganzes Unter-Genre, das des Geisterhauses und speziell des Spuks. Gleichzeitig streift er lovecraftschen Horror.
Ein besonders gelungenes Stück Kurzprosa ist auch „Das Nachtcafé“. „Das Nachtcafé“, das war auch seit den siebziger Jahren ein Freiburger Literaturmagazin, das mich lange begleitet hat. Vielleicht hat auch der Autor daran gedacht, als er den Titel wählte, ich weiß es nicht. Beschrieben wird ein Ort, nach dem wir uns alle sehnen: Einen Wohlfühlort, den wir als Fremder betreten, und in dem wir uns nach und nach immer wohler und behaglicher fühlen, in dem wir Gleichgesinnte treffen und Inspiration erfahren. Dabei, das macht Alexander Bach deutlich, ist es weniger der Ort, als vielmehr die Atmosphäre, die diese Einmaligkeit schafft - und die zu oft nicht wiederholbar ist, so sehr wir uns auch danach sehnen.
Nicht auf einen Ort, sondern auf eine Person bezogen, setzt sich die Thematik fort: In „Zwei Leben lang“ sieht der Erzähler ein Mädchen immer wieder, und es wird zum Objekt seiner Phantasie.
Mit 11 Seiten ungewöhnlich lang ist „Winterzeit“. Wieder eine Café-Geschichte, wieder ein Wohlfühlort, und gleichzeitig eine Parabel über die Zeit, deren Verschwendung und deren Auswirkung auf uns, wenn man versucht, sie zu manipulieren. Noch werden die Stunden im Sommer und Winter je eine Stunde zurück- und wieder vorgestellt. Unwillkürlich frage ich mich, was mit uns passieren und welche Auswirkungen es insbesondere auf unseren Verstand haben würde, wenn es sich nicht nur um eine Stunde, sondern um eine Woche, einen Monat, gar ein ganzes Jahr handeln würde…
In dem anschließenden Prosa-Stück „Tagträumer“ erlaubt uns der Autor zunächst einen beklemmenden Einblick in die Gefühlswelt eines auftretenden Literaten. Die Beschreibung des Zweifelns, des Wälzens über Sinn- und Trostlosigkeit vor einem Auftritt, dieses mulmige Gefühl - all das wird hier zwar leicht übersteigert dargestellt, es kennt jedoch jeder, der einmal allein auf einer Bühne stand und ein Stückweit seine Seele vor einem Publikum öffnen musste. Der Autor unterteilt diese Geschichte in „Tag“ und „Traum“… Im zweiten Teil begleiten wir den Protagonisten erneut, diesmal hinaus ins Freie, während sich ein Gewittersturm anbahnt, der in der Folge geradezu apokalyptische Ausmaße annimmt. Das seelische Leiden der Hauptperson ist kaum mehr erträglich; hier haben wir es mit einem Dichter zu tun, der mehr mit sich als mit seinem Werk ringt.
Auch hier stelle ich mir vor, wie ein Publikum ein solches Ausmaß an offenkundiger Selbstreflexion wohl aufgenommen haben mag. Der Autor schreibt in seinem Vorwort, dass er selbst damals erkannte, sich aus seiner eingesponnen Welt herauskämpfen zu müssen: Der Kampf gipfelte in eben diesem Stück, „einer aufwendigen Lesung vor Geräuschkulisse, die nur ein einziges Mal aufgeführt wurde und die eine Kunstpause und Zeit der Neuorientierung nach sich zog“.
Drei Jahre später entstand für eine Anthologie der Text „Blackwater“. Er zeigt, dass sich die Phantasie des Autors mehr noch als zuvor um sich selbst dreht, er seiner Hölle noch nicht entronnen ist, sie allenfalls kryptischer darzustellen weiß.
Der bislang einzig unveröffentlichte Text in der Sammlung, ein nur 1-seitiger „Bonus Track“ namens „Lösungsmittel“ bringt noch einmal auf den Punkt, worum diese ganzen Geschichten kreisen: Ja, der Autor ist, wie Jörg Kleudgen in seinem informativen Nachwort schreibt, „ein feinsinniger Beobachter“ - doch er beobachtet ausschließlich sich selbst und seine Gefühle, wobei er dabei wie ein Fremder neben sich steht. Besser als der Autor selbst kann man es nicht beschreiben: „Ich beuge mich dem Spiegel entgegen, schaue genau; ich weiß nicht einmal, was ich sehe. Sehe einen Fremden vor mir stehen.“
Ich vermute und entnehme dem Vorwort, dass sich Alexander Bach nach dieser frühen Periode von der Phantastik abgewandt, dass er sich freigekämpft hat aus dem Strudel. Jörg Kleudgen gebührt der Dank, diese frühen Geschichten des Autors vor dem Vergessen bewahrt zu haben. Neben den Romanen des Verlegers selbst, allen voran „Stella Maris“ ist dies das bedeutendste Werk innerhalb der Goblin Press.
Alexander Bach ist heute fast ausschließlich mit eigens verfassten Bühnenprogrammen unterwegs. Wer ihn erlebt, ist beeindruckt, mit welcher Virtuosität er seine Texte vorträgt, wobei er selbst hinter seiner Bühnenpräsenz als die eines etwas antiquiert wirkenden Gentleman zurücktritt. Auf YouTube gibt es einige Beispiele, auch Einlesungen wie zum Beispiel von dem „Haus in der Rotscherzgasse“ sind dort zu finden. Pünktlich zu Halloween und zur Walpurgisnacht beschert uns Alexander Bach zudem jeweils ein Juwel seiner „Eigentümlichen Geschichten“.
Wer Interesse an dem Buch hat, sollte sich sputen: Es ist auf 100 Exemplare limitiert und dürfte bald zu den gesuchtesten Publikationen der Goblin Press zählen.
Bestellungen sind per eMail möglich bei: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.