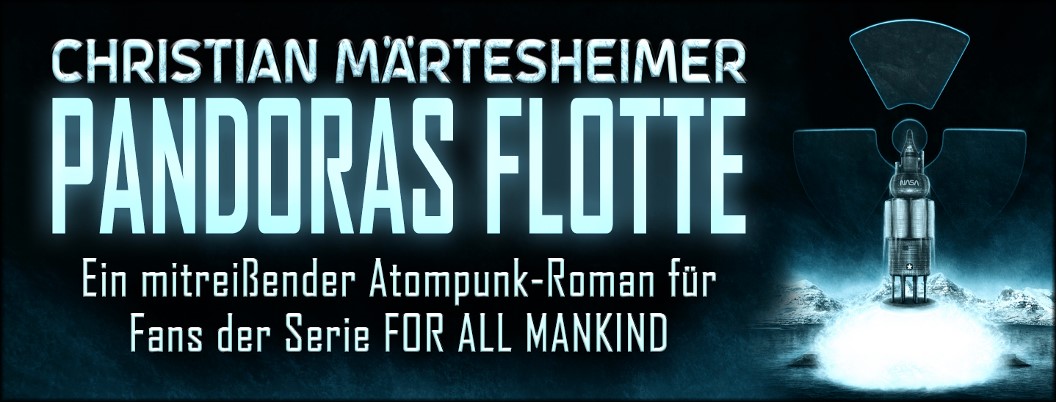Der geheime Garten vom Nakano Broadway (Comic)
- Details
- Kategorie: Rezensionen
- Veröffentlicht: Freitag, 29. März 2019 18:07
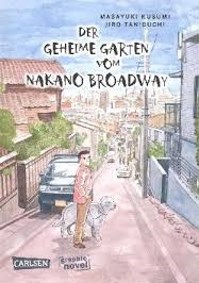
Der geheime Garten vom Nakano Broadway
(Sanpomono, 2006)
Story: Masayuki Kusumi
Zeichnungen: Jiro Taniguchi
Übersetzung: Sachiko und Achim Stegmüller
Nachworten und Fotos: Masayuki Kusumi
Carlsen, 2012, Paperback mit Klappenbroschur, 104 Seiten, 12,00 EUR, ISBN 978-3-551-72324-6
Rezension von Irene Salzmann
Masayuki Kusumi (auch Qusumi Masayuki) wurde am 15. Juli 1958 in Tokyo, Japan, geboren. Bevorzugt arbeitet er als Autor mit ausgewählten Zeichnern als Duo, darunter Jiro Taniguchi, mit dem er gemeinsam den Gekiga „Der geheime Garten von Nakano Broadway“ schuf. Bereits seit den 80er Jahren verfasst Masayuki Kusumi Manga-Storys, darunter „Kodoku no Gourmet“ („Le Gourmet Solitaire“).
Jiro Taniguchi, geboren am 14. August 1947 in der Präfektur Tottori, Japan, gestorben am 11. Februar 2017, debütierte nach seiner Zeit als Assistent von Kyota Ishikawa 1970 mit „Kareta Heya“ („A Desiccated Summer“) und schuf bis zu seinem Tod weit über 50 Einzeltitel und Serien, die sich weitgehend an ein reiferes Publikum wenden.
In den beiden Nachworten verrät Masayuki Kusumi, dass das Gerücht von einem geheimen Dachgarten, der nur den Bewohnern des Hauses zugänglich ist und in dem Frauen ihre Hunde ausführen, zu entsprechenden Recherchen und ausgedehnten Spaziergängen ohne konkretes Ziel oder einer Planung veranlasste. Er wollte Tokyo neu entdecken, ihm bekannte Viertel nach einigen Jahren wieder einmal besuchen und bislang unbekannte kennenlernen. Die gesammelten Erlebnisse und Eindrücke verarbeitete er in den acht Episoden von „Der geheime Garten von Nakano Broadway“. Die Fotos, die er anfertigte, dienten Jiro Taniguchi als Vorlagen für die aufwändigen, äußerst realistischen Zeichnungen.
Jouji Uenohara ist verheiratet, kinderlos und arbeitet in einer kleinen Firma. Wenn gerade kein Bus fährt, er eine Besorgung macht, einen Freund besucht, den Hund von Bekannten ausführt oder sich sonst eine Gelegenheit ergibt, unternimmt er planlos - ziellos: „Der Weg ist das Ziel.“ - ausgedehnte Spaziergänge, die ihn in Gegenden führen, die er schon lange nicht mehr betreten hat oder überhaupt nicht kannte.
Völlig frei von irgendwelchen Erwartungen betrachtet er Tokyo daher ganz unbefangen und aufgeschlossen. Er beobachtet aufmerksam und unterhält sich mit den Menschen in den Lokalen und Läden. Dabei wird er so manches Mal wehmütig, wenn er beispielsweise den Gebäude-Mix aus alt und neu studiert, ein traditionsreiches Geschäft, in dem er früher verkehrte, nicht mehr vorfindet oder ein Schild entdeckt, das daran erinnert, dass es sich bei der schicken Einkaufsstraße um die alte Tokaido-Straße handelt, die Edo und Kyoto verband/verbindet und über die einst Samurai reisten. Sehr hübsch sind Einzelheiten wie die Blumentöpfe an einer Straße mit Gefälle, die von kleinen Holzbrettchen gestützt werden, so dass sie gerade stehen, etwas, das vielen gar nicht auffallen würde.
Was Uenohara ahnt, bestätigen ihm die Anwohner: Das Alte wird immer mehr vom Neuen verdrängt. Der Autor und sein Protagonist kritisieren das nicht direkt, denn das Leben geht weiter, und Veränderungen, der Fortschritt lassen sich nicht aufhalten. Die jungen Leute bejahen diese Entwicklung, während die älteren bedauern, dass mit dem Traditionellen auch viel Schönes und Eigentümliches verschwindet. Umso überraschter reagiert die Hauptfigur auf die Entdeckung eines Hippie-Festivals, das nicht nur jene anzieht, die wenigstens in seinem Alter sind, sondern auch die jüngeren.
Der Protagonist wird mit seiner Vergangenheit und den logischen Schlussfolgerungen zu einer nahen Zukunft konfrontiert. Er nimmt den ständigen Wandel wahr, der durchaus auch eine Rückbesinnung zulässt. Dabei drängt sich ihm die Frage auf, die sich gewiss jeder schon einmal gestellt hat: Was wird von ihm selbst nach fünfzig Jahren bleiben? Wie wäre sein Leben verlaufen, wenn er im Beruf etwas ambitionierter gewesen wäre, in das andere Haus eingezogen wäre und Kinder bekommen hätte? Er kann das Rad nicht zurückdrehen und akzeptiert letztendlich sein in Fluss befindliches Leben, aus dem er keinen Moment hatte ausbrechen wollen. Tatsächlich genügen ihm die Spaziergänge als Ausgleich zum Alltag, und er genießt es, sein Dasein durch die neuen Eindrücke und Gedankenspiele zu bereichern.
Der stille, nostalgische Gekiga besticht durch die ansprechenden Zeichnungen, die man gern in einem größeren Format sehen würde, wobei das Paperback bereits ein Zugeständnis ist - im Bunko-Format bräuchte man wahrscheinlich eine Lupe für die kleine Schrift und das Erkennen von Details.
Man erfährt, dass Jiro Taniguchi die Illustrationen von den Fotos abgepaust und aufwändig mit Rasterfolie Schattierungen hinzugefügt hat, weil der teilweise Einsatz von Tusche (in der ersten Episode) nicht ganz die eigenen Erwartungen erfüllte. Auch die Kritik, weil so kaum noch künstlerische Eigenleistungen geliefert werden, wurde in den Nachworten angesprochen. Wer das bemängelt, ob zu Recht oder nicht, vergisst, dass zum Beispiel Boris Vallejo auf Leinwand projizierte Fotovorlagen nachzeichnete und kaum noch ein Buchcover gemalt sondern eine Montage aus Fotos, Clipart und ähnlichem ist.
Ein angenehmer, nachdenklicher Gekiga, der sich wohltuend vom (Kiddie-) Manga-Einerlei abhebt und auch Lesern gefallen dürfte, die eher den Frankobelgiern zugeneigt sind.